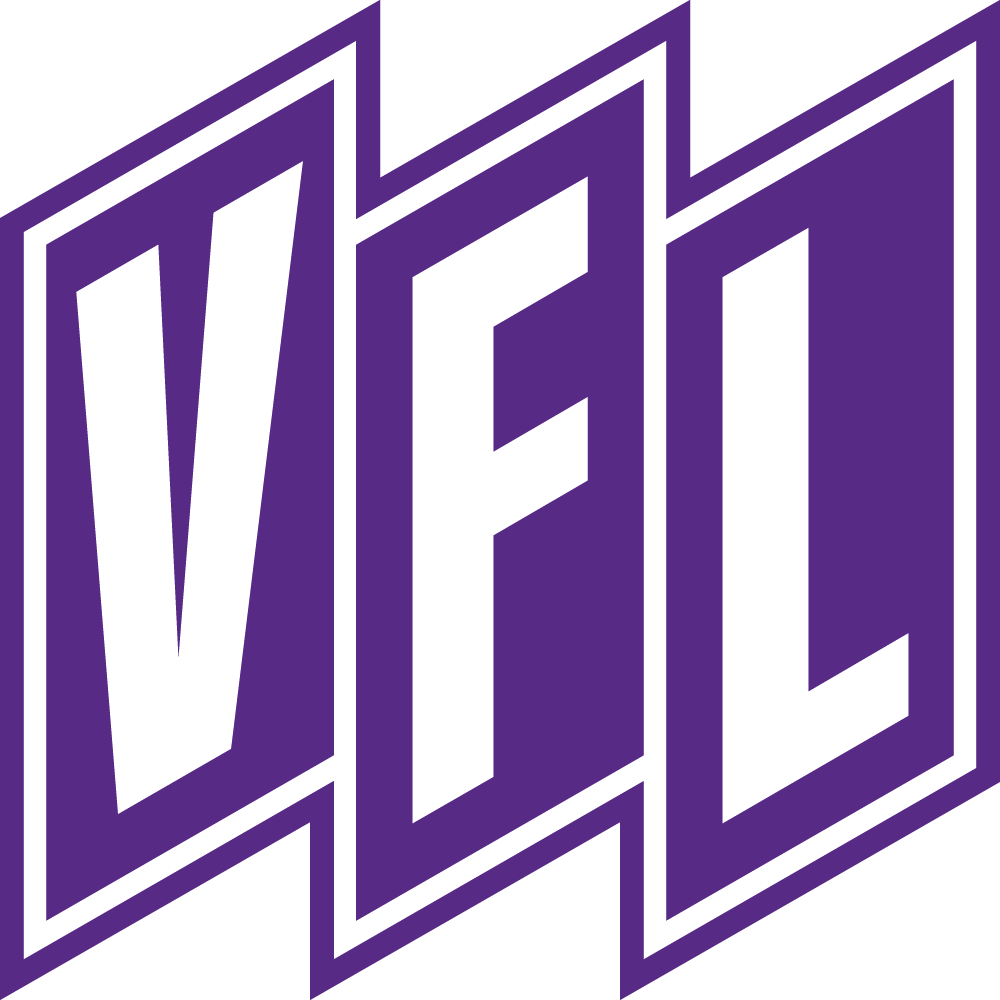Aus Anlass des Jahrestages der Pogromnacht von 1938 besuchte eine Gruppe von rund 20 VfL- Fans am Montag, 10. November die Gedenkstätte Gestapokeller im Osnabrücker Schloss. Ziel des Besuchs war es, sich gemeinsam mit der Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in der Region auseinanderzusetzen und die Bedeutung des Erinnerns im heutigen Alltag bewusst zu machen.
In der Pogromnacht war es wie im gesamten Deutschen Reich zu Ausschreitungen, Brandstiftungen, Plünderungen und sogar Morden gekommen. Die Osnabrückerin Regina Hermanns erinnert sich:
„Ich werde diese grausame Nacht niemals vergessen. Wir wohnten in der Katharinenstraße 21. Die Wohnung war taghell erleuchtet durch die brennende Synagoge in der Rolandstraße. Mein Bruder und ich hatten furchtbare Angst, weil auf der Straße eine Menschenmenge stand und manche Leute schrien, man solle meinen Vater an der Laterne aufhängen. Meine Mutter weinte und niemand wusste, wohin man meinen Vater brachte.“
Die VfL-Fans, die der Einladung des Bündnisses Tradition lebt von Erinnerung gefolgt waren trafen sich zunächst am Stolperstein von VfL-Mitglied Felix Löwenstein, der am 10. November 1938 erstmals in „Schutzhaft“ genommen und wie etwa 80-90 weitere jüdische Männer aus Osnabrück in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt worden war. Hier waren in den folgenden Tagen bereits drei der Männer nach Misshandlungen durch die Wachmannschaften gestorben.
Antisemitismus und Judenverfolgung in Deutschland fanden nicht im Verborgenen statt – und als Instrument der totalen Gleichschaltung, Überwachung und des staatlichen Terrors wirkte auch die Gestapo daran mit.
Nach der obligatorischen Reinigung des Stolpersteins folgte die etwa anderthalbstündige Führung im Gestapokeller. Hier erhielten die Teilnehmenden einen eindrucksvollen Einblick in die Geschichte des Gebäudes, das während der NS-Zeit als Haft- und Verhörort der Gestapo diente. Die Führung thematisierte sowohl die Schicksale der dort inhaftierten Menschen als auch die gesellschaftlichen Strukturen, die solche Verbrechen ermöglichten.
Die Gruppe zeigte sich tief beeindruckt von den authentischen Räumen und den persönlichen Geschichten der Opfer, die in der Ausstellung dokumentiert sind. Im Gespräch wurde deutlich, wie wichtig es ist, Erinnerungskultur auch über den Fußball hinaus lebendig zu halten und Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Denn: Oft reicht es nicht, zu erinnern. Heute heißt es auch, derartigen Tendenzen entschieden entgegenzutreten und ihnen Einhalt zu gebieten.
Text: David Kreutzmann